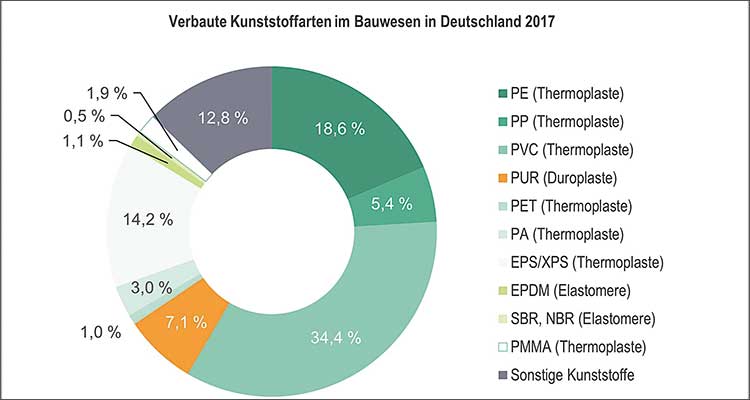Marc Wilhelm Lennartz
Modulare Energieversorgung im Holz-Hybridbau mit Eisspeicher
Wärmepumpe, Solarstrom, Solarwärme und Eisspeicher für autarkes Wohnen bei niedrigen Kosten
In Nordrhein-Westfalen hat eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft erstmals in Holz und mit einem weitreichend autarken Versorgungsmosaik gebaut. Das Pilot- und Leuchtturmprojekt dient als Blaupause für zukünftige Bauvorhaben. Zentraler Bestandteil ist die intelligente und gleichzeitig kosteneffiziente Energieversorgung mit Eisspeicher, Wärmepumpe und Solarstrom.
KERNAUSSAGEN
- Teilautarke Energieversorgung durch intelligentes System aus Eisspeicher, Wärmepumpe und Solarstrom
- Holz-Hybridbauweise als Grundlage für Energieeffizienz
- Modellprojekt für zukunftsfähiges Wohnen bei niedrigen Betriebskosten