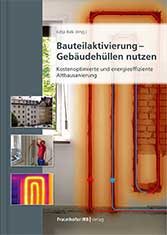Das Fachgebiet Architektur der Transformation präsentiert im Rahmen einer neuen Ausstellung zukunftsfähige Entwürfe für die Neugestaltung und Umnutzung von Einfamilienhausgebieten. Unter dem Titel »CO-MAKABI Praktiken des Teilens im Einfamilienhaus« zeigen Masterstudentinnen und -studenten unter der Leitung von Fachgebietsleiterin Prof. Nanni Grau, wie bestehende Wohnstrukturen sozial, ökologisch und räumlich weiterentwickelt werden können.
Das Einfamilienhaus ist die populärste Wohnform in Deutschland – 53% der Menschen wünschen sich, in einem Einfamilienhaus zu leben. Gleichzeitig ist es auch die häufigste Wohnform: Mehr als 16 Mio. Einfamilienhäuser machen etwa die Hälfte des gesamten Wohnungsbestandes aus. Trotz einer durchschnittlichen Belegung von nur 1,8 Personen pro Haus steigt die Häuserzahl kontinuierlich – in den letzten 20 Jahren um etwa 100.000 pro Jahr.
Doch die Wohnform des Einfamilienhauses steht zunehmend in der Kritik. Angesichts der Klimakrise, des Wohnraummangels und diverser Lebensentwürfe werden der hohe Material-, Energie- und Flächenverbrauch sowie die unflexiblen Raum- und Eigentumsstrukturen hinterfragt. Vor diesem Hintergrund sieht das Masterstudio Co-MaKaBi der TU Berlin die Zukunft des Einfamilienhauses nicht im Neubau, sondern im Teilen und Transformieren des Bestehenden.
Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
In den Berliner Bezirken Mahlsdorf, Kaulsdorf und Biesdorf (MaKaBi), dem größten deutschen Einfamilienhausgebiet, haben die Studierenden zunächst die Qualitäten des Gebäudebestands und alltägliche Praktiken des Teilens untersucht. In Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wurden neue, erweiterte Modelle des Zusammenlebens entwickelt, die auf gemeinsamen Nutzungen und räumlicher Flexibilität basieren. Ziel ist es, neue Bodenversiegelungen zu vermeiden und energetische Sanierungskonzepte mit robusten, anpassungsfähigen räumlichen Lösungen zu verbinden. Zudem werden Alternativen zu privaten Eigentumsmodellen vorgeschlagen, einschließlich neuer Finanzierungsformen.
Die Studierenden gingen dabei sensibel vor und entwickelten Strategien, um Gehör bei den Anwohnerinnen und Anwohnern zu finden. Während einige Projekte durch persönliche Kontakte und die Unterstützung mit Grundrissen profitieren konnten, stieß die Idee bei anderen auf Desinteresse. Besonders ältere Menschen zeigten dabei eine größere Offenheit gegenüber den vorgestellten Konzepten.
Entwürfe für eine nachhaltige Zukunft
Eines der Projekte, »Mehr-Als-Familienhäuser«, untersucht die Straße als kollektiven Raum und hinterfragt die traditionellen Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum. Durch gezielte Interventionen wie die Umnutzung von Garagen für nachbarschaftliche Zwecke und die Integration von Balkonen werden neue Begegnungszonen geschaffen. Die Straße wird so schrittweise zu einem lebendigen Zentrum für die Gemeinschaft.
Mit dem Entwurf »Das Haus im Grünen!« wird die Biodiversität in suburbanen Gebieten in den Mittelpunkt gestellt. Architektur und Natur verschmelzen: Durch gezielte bauliche Maßnahmen wie die Öffnung von versiegelten Flächen und das Schaffen von naturnahen Lebensräumen entsteht eine enge Verbindung zwischen Wohnraum und Garten, wodurch Mensch und Natur nachhaltig profitieren.
Kollektive Ansätze für gemeinschaftliches Wohnen
Ein weiteres Beispiel ist der Entwurf »Nabel«, der ungenutzte Restflächen an den Schnittpunkten von bis zu sechs Parzellen in gemeinschaftliche Räume transformiert. Durch die Neugestaltung der Grundstücksgrenzen entsteht eine zentrale Gemeinschaftsfläche, die genossenschaftlich organisiert wird. Hier entstehen multifunktionale Orte wie gemeinschaftliche Küchen, Co-Working-Spaces oder Wellnessbereiche.
Die Wohnwerkstatt e.V. erforscht, wie das Einfamilienhaus schrittweise und bedarfsgerecht transformiert werden kann. Dabei stehen soziale und finanzielle Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von barrierefreien Umbauten bis hin zur Nachverdichtung durch Aufstockungen und werden in Kooperation mit einem Verein realisiert.
Verglichen mit dem Neubau erfordert eine Transformationspraxis des Einfamilienhausbestands ein verändertes Instrumentarium an Werkzeugen, Ideen und Wissen, das im Rahmen der Ausstellung geteilt wird. »Einfamilienhäuser für alle!« geht als Umbau-Laboratorium der Frage nach: Wie können bestehende Einfamilienhaussiedlungen zum Modellraum einer neuen, dringend notwendigen Umbaupraxis und damit auch zum Gegenstand einer kritischen architektonischen Diskussion und Praxis werden?
Veranstaltungsdetails
Ort: Architektur Galerie Berlin
Karl-Marx-Allee 96
10243 Berlin
Ausstellung: 21. Februar – 21. März 2025
Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag, 14.00 – 19.00 Uhr, Samstag, 12.00 – 18.00 Uhr
Kontakt
Prof. Nanni Grau
Fachgebietsleiterin Architektur der Transformation
Fakultät Planen Bauen Umwelt
TU Berlin
E-Mail: grau@tu-berlin.de